
Elternabend zum Thema "Medienerziehung"
Wir laden Sie herzlich ein zum digitalen Elternabend "Zwischen Smartphone und Schnuller" für Eltern mit Kindern zwischen 0-5 Jahren am 9. Juli 2024 um 18.30h.
[mehr]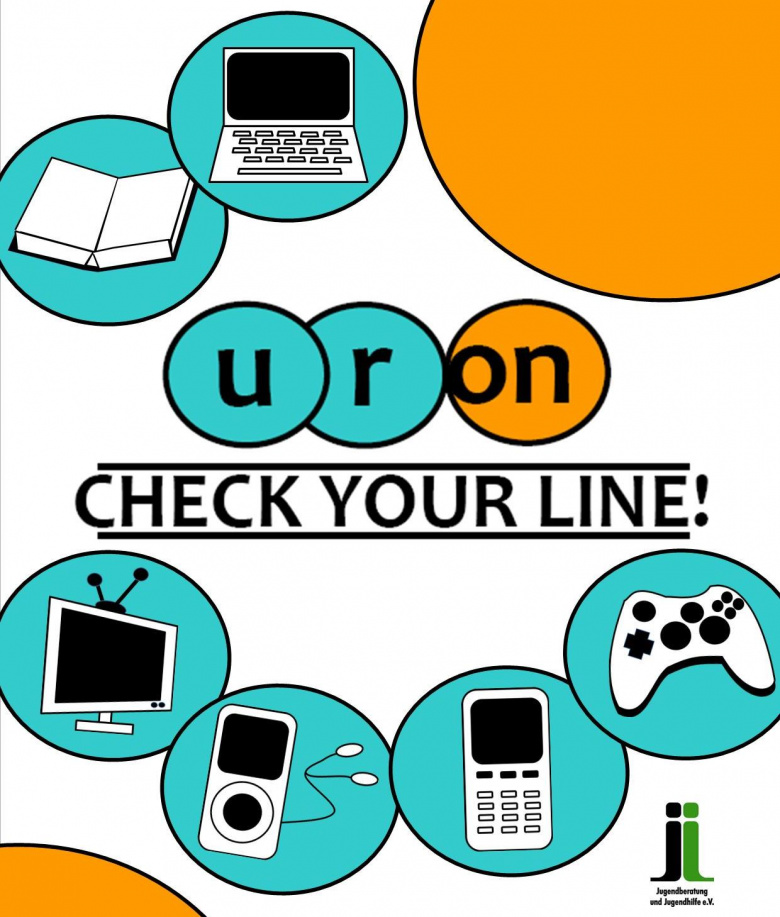
Medienkompetenzprojekt in Wiesbaden sucht Honorarkräfte
Das Suchthilfezentrum Wiesbaden sucht für das interaktive Medienkompetenzprojekt "u.r.on. - check your line!" im Herbst noch Honorarkräfte, die uns bei der Umsetzung des Projektes unterstützen!
[mehr]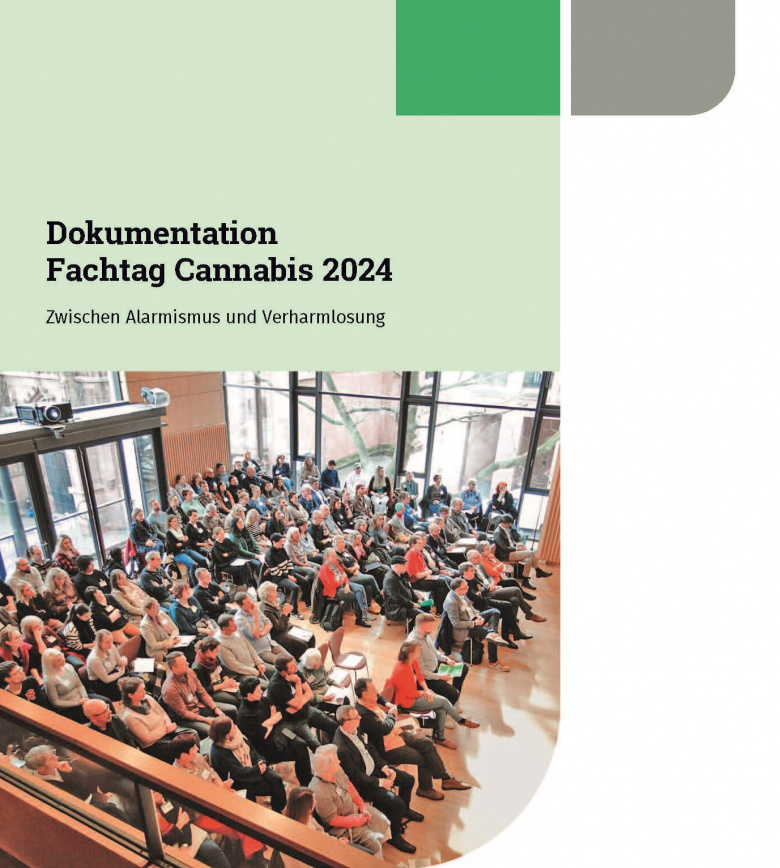
Fachtag Cannabis 2024
Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten des Fachtages »Cannabis – zwischen Alarmismus und Verharmlosung«, der am 15.02.2024 im Haus am Dom in Frankfurt am Main stattgefunden hat. Uns, dem JJ-Organisationsteam, hat es gefallen. Den über 160 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch, so zumindest die zahlreichen Rückmeldungen.
In unserer Dokumentation können auch alle, die nicht dabei sein konnten, nachlesen, um was es auf der ganztägigen Veranstaltung im Detail ging. Dort finden Sie die wesentlichen Inhalte der Vorträge und Workshops sowie eine Kommentierung der Cannabis-Legalisierung aus der Perspektive der Suchthilfe.
Die Fachtags-Dokumentation können Sie hier downloaden.
Die Vortragsunterlagen können Sie nachstehend lesen und herunterladen.
[mehr]
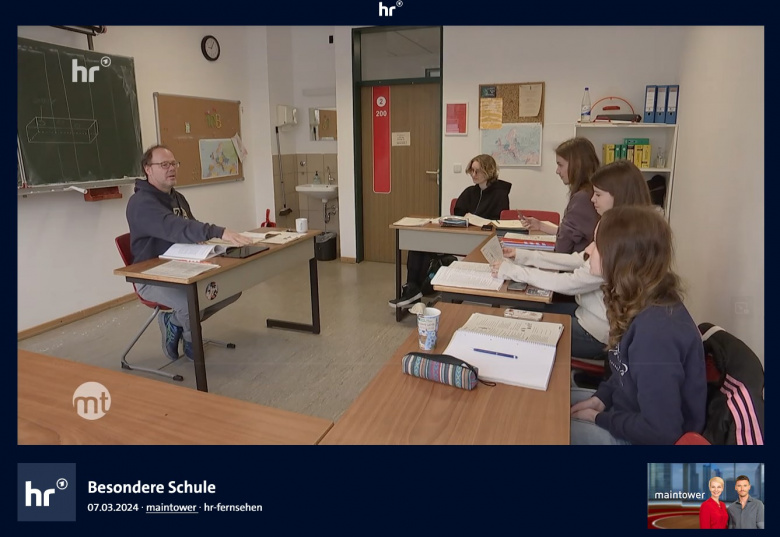
Eine besondere Schule im "maintower"
Mitwoch gedreht, Donnerstag veröffentlicht - so schnell ging es mit dem Beitrag über das BZH im hr-Fernsehen
[mehr]
Mediennutzung bei Menschen mit einer stoffgebundenen Abhängigkeit
Nicht nur in der Suchthilfe, sondern in der gesamten Gesellschaft erfährt die Thematik „intensiver Medienkonsum“ eine zunehmende Bedeutung. Es ist damit zu rechnen, dass die gesundheitspolitische Relevanz der Folgen der Digitalisierung eher zu- als abnehmen wird. Die Ergebnisse einer JJ-internen Untersuchung zum Thema „Mediennutzung bei Menschen mit einer stoffgebundenen Abhängigkeit“ sind gestern in der Zeitschrift Konturen erschienen.
[mehr]
Kreative Weihnachtsferien
Vom 08.01.2024-12.01.2024 fand die JJ-Weihnachtsferienbetreuung der Stadtschule Butzbach statt. Bis zu 42 Kindern verbrachten die erste Betreuungswoche des neuen Jahres in den Räumen der Alten Turnhalle. Es wurden Holzklötze zu winterlichen Figuren umgestaltet, sich kreativ auf einer Leinwand und in einem Indoorspielplatz ausgetobt und geschlemmt.
[mehr]